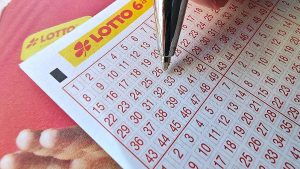Der Bestand der Felchen im Bodensee befindet sich in einer kritischen Lage. Im Fangjahr 2023 wurden lediglich 9,9 Tonnen Felchen gefangen – ein Rückgang von 94 Prozent gegenüber dem ohnehin geringen 10-Jahres-Mittel von 165 Tonnen. Als Reaktion darauf hat die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) im Juni 2023 eine dreijährige Schonzeit für Felchen im Bodensee-Obersee beschlossen, die seit Januar 2024 in Kraft ist.
Vielfältige Ursachen für den Bestandsrückgang
Die Gründe für den dramatischen Ertragsrückgang sind komplex:
- Nährstoffarmut: Der Bodensee ist wieder nährstoffärmer geworden, was das Nahrungsangebot für Felchen reduziert.
- Invasion des Stichlings: Seit 2012 hat sich der kleine Stichling explosionsartig vermehrt und dominiert nun das Freiwasser des Sees, den Hauptlebensraum der Felchen.
- Klimawandel: Steigende Wassertemperaturen beeinträchtigen die Entwicklung von Felcheneiern und -larven.
Alarmierende Forschungsergebnisse
Wissenschaftler der Universität Konstanz und der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg haben im Rahmen des Projekts „Resilience of Lake Ecosystems“ die Auswirkungen höherer Wassertemperaturen auf Felchen untersucht. Die Biologen Barnaby Roberts und Alexander Brinker stellten fest:
- Frühzeitiges Schlüpfen: Höhere Temperaturen führen dazu, dass Larven bereits Ende Januar statt im Februar schlüpfen, wenn noch nicht genug Nahrung verfügbar ist.
- Erhöhte Ei-Sterblichkeit: Wärmeres Wasser begünstigt den Befall der Eier durch Mikroorganismen.
- Schnellerer Verbrauch der Energiereserven: Der Dottersack der Larven wird bei höheren Temperaturen schneller aufgebraucht.
Klimawandel als Hauptbedrohung
Die Studie zeigt, dass die zunehmende Erwärmung des Sees infolge des Klimawandels die größte Bedrohung für die Fischerei am Bodensee darstellt. Der Naturschutzbund Nabu betont, dass nicht der Kormoran, wie oft vermutet, sondern der Klimawandel der Hauptfaktor für den Bestandsrückgang sei. Johannes Enssle, Nabu-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, erklärt: „Alle, die in der Politik derzeit so lautstark den Kormoran zum Übeltäter erklären und mit ihm den Untergang der Bodenseefischerei verbinden wollen, sollten damit eines Besseren belehrt sein.“
Schutzmaßnahmen und Zukunftsperspektiven
Um den Felchenbestand zu schützen, setzen Wissenschaftler auf gezielte Aufzuchtprogramme. Dabei werden größere Besatzlarven herangezogen, die die kritischen ersten Lebenswochen in kontrollierter Umgebung verbringen. Diese Maßnahme, kombiniert mit dem Fangverbot, soll den Felchen helfen, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen.
Langfristige Lösungsansätze
Experten betonen, dass langfristig nur eine Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen die Erwärmung der Gewässer aufhalten kann. Die Erhaltung der Felchenpopulation ist nicht nur für die regionale Fischerei von Bedeutung, sondern auch für das gesamte Ökosystem des Bodensees. Gezielte Schutzmaßnahmen und weitere Forschung bleiben unerlässlich, um die Zukunft der Felchen im Bodensee zu sichern und das empfindliche Gleichgewicht des Sees zu bewahren.